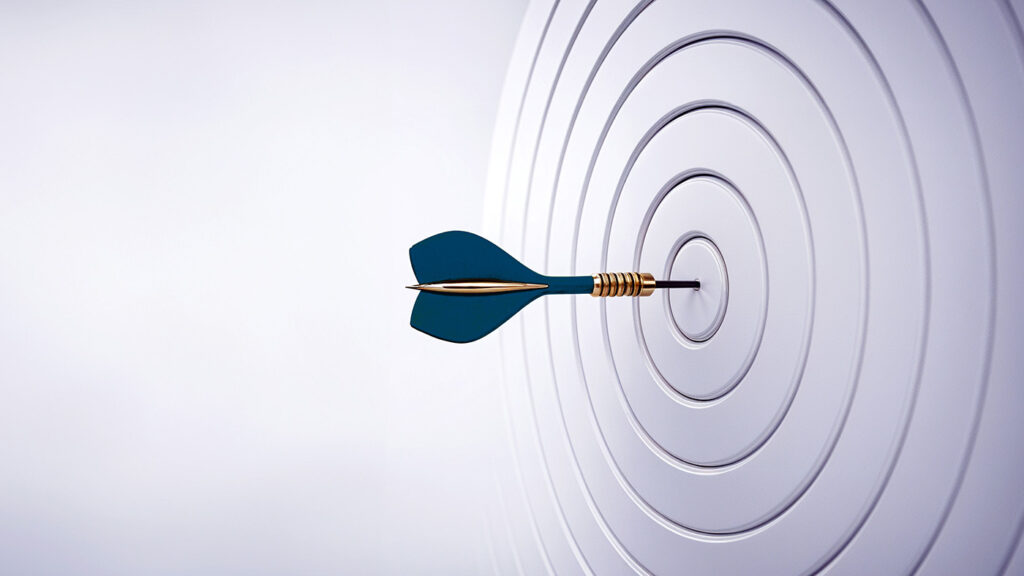Lange galt Strategie als ein exklusives Spielfeld: oben denken, unten umsetzen. Der Vorstand, der Verwaltungsrat oder die Geschäftsleitung beauftragte eine Beratungsfirma, liess ein Konzept entwickeln – und dann wurde es „ausgerollt“. Doch diese klassische Top-Down-Logik funktioniert immer seltener. Warum? Weil Strategie heute keine rein theoretische Disziplin mehr ist, sondern tief in den Alltag der Organisation eingreift. Und weil Menschen, die sich nicht einbezogen fühlen, selten mit Überzeugung handeln.
Die alte Logik: Effizienz durch Exklusivität
In der Vergangenheit war es oft sinnvoll, Entscheidungen in kleinen, konzentrierten Kreisen zu treffen. Strategien sollten schlank, schnell und entschlossen aufgesetzt werden – unter Ausschluss der operativen Welt. Die Annahme dahinter: Nur aus der Distanz ergibt sich der nötige Überblick.
Doch diese Denkweise greift heute zu kurz. In dynamischen Märkten, komplexen Stakeholder-Landschaften und hochgradig vernetzten Unternehmen wird Strategie zur gelebten Praxis – und muss von Anfang an auch als solche gedacht werden.
Zudem ist auch die Diversität und ihre nachweisliche Relevanz im Sinne des Geschäftsergebnisses ins Bewusstsein durchgedrungen und hat ihren restlichen Teil dazu beigetragen, dass sich die Vorgehensweise in puncto Strategie ändert.
Strategie ist kein PowerPoint-Projekt
100-mal gehört. Mindestens genauso oft das Gegenteil erlebt. Geht es Ihnen auch so? Was nützt die brillanteste Strategie, wenn sie in der Organisation verpufft? Wenn sie zwar in Folien beeindruckt, aber in der Realität keinen Widerhall findet? Genau hier beginnt das Problem der klassischen Top-Down-Ansätze: Sie verlieren an Wirksamkeit, weil sie Beteiligung mit Geschwindigkeit verwechseln – und Umsetzung mit Anordnung.
Moderne Strategieerarbeitung braucht mehr als reine Analysekompetenz – sie braucht Beteiligungskompetenz.
Co-kreative Strategieberatung: gemeinsam denken, handeln, lernen
Heute sind die erfolgreichsten Strategien jene, die von Anfang an gemeinsam gedacht werden. Das bedeutet nicht, dass alles basisdemokratisch entschieden werden muss. Aber es bedeutet: Die Menschen, die später in der Umsetzung Verantwortung tragen, sollen frühzeitig mitgestalten können. Das erzeugt nicht nur Akzeptanz, sondern verbessert auch die Qualität der Strategie – denn wer täglich mit Kunden, Prozessen oder Produkten zu tun hat, bringt eine Perspektive mit, die kein Beraterbüro und selten auch eine vom Tagesgeschäft entfernte Geschäftsleitung ersetzen kann.
Neue Rolle für Beratende – und für Führung
Beratende sind heute weniger die „klugen Köpfe mit der einen Lösung“, sondern vielmehr Moderierende, Sparringspartner:innen und Katalysatoren. Sie begleiten Prozesse, schaffen Räume für Dialog, strukturieren Diskussionen, bringen Impulse von aussen – und ermöglichen, dass Organisationen ihre Lösung selbst (er)finden.
Führungskräfte wiederum müssen sich trauen, Kontrolle ein Stück weit abzugeben – und Vertrauen zu investieren. Das ist herausfordernd, aber notwendig. Denn in einem Zeitalter, in dem sich Märkte schneller ändern als Fünfjahrespläne geschrieben werden können, ist Lernfähigkeit wichtiger als Planbarkeit.
Drei Prinzipien moderner Strategieberatung
- 1. Beteiligung statt Betroffenheit: Wer mitgestaltet, steht hinter dem Ergebnis – und trägt es weiter.
- 2. Kontext schlägt Konzept: Jede Strategie muss zur Kultur, zum Reifegrad und zur Realität des Unternehmens passen – statt ein Fremdkörper zu sein.
- 3. Strategie ist Prozess, nicht Produkt: Sie entwickelt sich laufend weiter – durch Feedback, Learnings und das, was in der Praxis funktioniert.
Fazit: Strategie neu denken heisst gemeinsam denken
Top-Down hat nicht ausgedient – aber es reicht allein nicht mehr aus. Eine Strategie zu erarbeiten, muss heute Brücken bauen zwischen Analyse und Umsetzung, zwischen Vision und Alltag, zwischen Führung und Mitarbeitenden.
Denn nur wenn Strategie im Kopf wie im Herzen der Organisation ankommt, wird sie wirksam. Alles andere bleibt schöne Theorie.